Ein Gespräch mit Simone Leuenberger und Markus Fankhauser über Unerhörtes und Ungerechtes in ihrem Leben, in Kirche und Gesellschaft. Das Interview ist in der Infozeitschrift 2-2021 von Glaube und Behinderung im Oktober 2021 erschienen.
Liebe Simone, lieber Markus. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt für dieses Gespräch. Könnt ihr uns zum Einstieg aufzeigen, in welchen Situationen es vorkommt, dass ihr euch nicht gehört bzw. ernstgenommen fühlt? Oder gibt es ein bestimmtes Erlebnis, das euch noch besonders in Erinnerung ist?
Simone: Es wird immer dann problematisch, wenn andere meinen, sie wissen es besser und mich nicht fragen. Oder wenn man sogar für mich entscheidet, was geht und was nicht geht. «Da kannst du nicht mitkommen» oder «Wir sind dann schon da und helfen dir …» und reissen dann an meinem Rollstuhl herum oder wollen mich auf einen Stuhl hieven.
Ein konkretes Beispiel ist auch der öffentliche Verkehr, den ich nach wie vor nur mit vorgängiger Anmeldung benützen kann. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich mich zwar angemeldet habe und sogar die Bestätigung in der Hand hatte. Meine Reservation war aber nicht im Computer und so sagte man mir, dass ich deswegen nicht befördert werden kann. Wenn du dann alleine am Gare de Lyon in Paris stehst und nach Hause willst, fühlst du dich schon ziemlich daneben.
Markus: Mir fallen dazu Situationen ein, in denen jemand zum Beispiel in einem Restaurant oder in einem Spital mit mir etwas besprechen wollen, aber nur mit meiner Begleitperson kommunizieren. Bei Leuten, die mich zum ersten Mal sehen, habe ich da zu Beginn sogar noch Verständnis. Wenn sie aber erkannt haben, dass ich sprechen kann und im Kopf gesund bin, dann erwarte ich, dass sie direkt mit mir sprechen. Ab und zu muss ich meine Begleitpersonen darauf hinweisen, dass sie am besten keine Antwort geben sollen. Manchmal gibt es aber auch Probleme, wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin oder eingeladen wurde. Wenn man schon weiss, dass ich dabei sein werde, und man wählt einen Ort aus mit zwei Treppenstufen vor dem Eingang, dann fühle ich mich nicht wirklich willkommen.
Was erlebt ihr mit Blick auf euer eigenes Leben als besonders ungerecht?
Markus: Sehr verletzend finde ich, wenn ich zum Beispiel bei einer Begrüssung einfach übergangen werde. Beispielsweise in einer Begrüssungsrunde, da wird allen anderen die Hand geschüttelt (mindestens war es vor Corona so) und wenn dann ich an die Reihe komme, macht die Person nur eine Winkbewegung aus der Ferne. Dies löst in mir ein Gefühl der Distanzierung und des Unberührbar-seins aus und das schmerzt.
Simone: Ich habe keine Hemmungen, meine Stimme zu erheben und weiss auch, wie ich mich wehren kann. Es macht mich aber traurig und zugleich wütend zu sehen, dass es viele Leute gibt, die das nicht können und wirklich übergangen und ungerecht behandelt werden. Anderseits finde ich es belastend, wenn meine Freundinnen und Freunde wegen mir unnötige Aufwände auf sich nehmen müssen, weil es zum Beispiel kein Behinderten-WC in der Nähe hat und durch die Suche nach einer Lösung viel Zeit verloren geht. Ein weiterer Punkt: Unter dem Begriff «crip time» versteht man vor allem im englischsprachigen Raum die Zeit, die ich als Behinderte mehr brauche, um meinen Alltag zu bewältigen. Ich brauche mehr Zeit zum Aufstehen, für den Unterhalt meiner Hilfsmittel, vielleicht mehr Arzttermine oder auch nur mehr Zeit, mich auszuruhen. Dieses Verständnis ist hierzulande noch nicht wirklich vorhanden Und zum Schluss: Auch die Tatsache, dass ich erst bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 40 % Anrecht auf eine IV-Rente habe, finde ich unerhört, weil es eine Sozialversicherung mit einem Selbstbehalt von 40 % eigentlich nicht geben darf.
Wie erlebt ihr das «Gehörtwerden» in der Kirche/Gemeinde? Werdet ihr dort eher wahr- und ernstgenommen?
Markus: Aus meiner Erfahrung steht und fällt es mit den Leuten. Haben die Menschen in der Kirche/Gemeinde ein Herz für Menschen mit Behinderungen? In meiner Jugendgruppe habe ich es zum Beispiel sehr gut erlebt. Weil die Leitung mich immer mitgedacht hat und auch keinen Aufwand gescheut hat, mir das Dabeisein zu ermöglichen, hat sich in der ganzen Gruppe auch eine Kultur der Inklusion entwickelt. In den Homecamps hatte ich zum Beispiel immer die Hilfe, die ich brauchte, und musste auch nie hungrig ins Bett. Alle hatten wie selbstverständlich auch ein Auge für mich. Inzwischen war ich aber auch schon in Gemeinden unterwegs, in denen ich mir eher wie ein Fremdkörper vorkam. Wenn ich in Gesprächen auf meine Behinderung reduziert werde, dann fühle ich mich sehr unwohl. Ich denke, es hat etwas mit dem Spannungsfeld zu tun, in welchem viele Christen stecken. Die Bibel ruft uns einerseits auf, alle Menschen zu lieben und zu achten (sozial zu sein …), anderseits sind einige überfordert, dies in der Praxis umsetzen und zu leben. Schwierig finde ich, wenn gegen aussen kommuniziert wird, wie willkommen Menschen mit Behinderungen sind, einem dann in der Praxis ein kühles Klima begegnet und ich mich dann doch nicht so willkommen fühle. Das erlebe ich aber nicht nur in Kirchen, sondern auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft.
Simone: Ich bin Teil einer Hausgemeinde. Dort bin ich ein vollwertiger Teil der Gemeinschaft wie alle anderen auch. Ich werde nicht auf meine Behinderung reduziert, kann mich in allen Themen einbringen und werde als Person ernst genommen. Dort gehöre ich wirklich dazu. Weil man mich schon lange kennt, haben alle einen ganz natürlichen Umgang mit mir.
Wenn ich in eine andere Gruppe bzw. Gemeinde gehe, dann macht es einen grossen Unterschied, ob ich alleine dort aufkreuze oder Leute dabeihabe, die mich kennen. Gute erste Begegnungen sind möglich, wenn eine mir unbekannte Person mich als Mensch wahrnimmt und mich als Mensch kennenlernen will.
Auf einer ganz allgemeinen Ebene habe ich aber den Eindruck, dass Behinderung in der Kirche nach wie vor kein Thema ist. Es ist ähnlich wie in der Welt: Die «Gesunden» sind die Starken und die Menschen mit Behinderung sind die Schwachen, denen man helfen und die man schützen muss. Diese Haltung verhindert, dass wir teilhaben können. Wir sind zwar irgendwie dabei, gehören aber nicht wirklich dazu. Ich vermisse den echten Wunsch, Menschen mit Behinderung auf Augenhöhe zu begegnen, sie ernst zu nehmen und ihnen zu ermöglichen, gleichwertige Teile der Gemeinschaft zu sein.
Wie hilft euch der Glaube an Jesus, mit solchen Situationen und den betreffenden Menschen umzugehen? Habt ihr Vorbilder aus der Bibel, die euch Mut machen?
Simone: Ich interpretiere die Bibel so, dass ich über den erlebten Ungerechtigkeiten nicht schweigen muss, sondern mich wehren darf. Bereits Mose hat dem Volk Israel mitgegeben: «Du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor den Blinden kein Hindernis legen, …» (3. Mose 19,14). Daraus erkenne ich den Auftrag an die Gemeinde, ein hindernisfreies Umfeld zu schaffen. Es gibt mir auch die Legitimation, mich dafür einzusetzen. Es gibt auch viele Vorbilder in der Bibel: Mose lebte zum Beispiel mit Assistenz; Aaron sprach für ihn vor dem Pharao. Zachäus hatte als Kleinwüchsiger einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt. Jesus behandelte Zachäus wie jeden anderen auch und lud sich bei ihm zum Essen ein. Paulus war als Missionar in der ganzen Welt unterwegs, obwohl er an chronischen Schmerzen litt. Auch die ausgerenkte Hüfte hinderte Jakob nicht daran, seine Aufgabe wahrzunehmen. Das macht mir Mut, mich für eine inklusive Gemeinde einzusetzen. Dies möchte ich aber nicht als nervige «Stänkerin» machen, sondern bei einer Beanstandung den Menschen mit Wertschätzung begegnen.
Markus: Mir hilft der Glaube dahingehend, dass ich mich in enttäuschenden oder verletzenden Situationen nicht verkrampfe und den Menschen mit Barmherzigkeit und Vergebung begegnen kann. Oft versuche ich in Situationen, in denen ich nicht persönlich angesprochen und damit nicht ernst genommen werde, die Leute zu sensibilisieren. Das braucht immer wieder viel Geduld und Liebe. Es wäre viel einfacher, seinem Frust freien Lauf zu lassen. Ich bin aber dankbar, dass mir Gott immer wieder die Gelassenheit gibt, ruhig zu reagieren und positiv zu bleiben.
Ihr seid beide beruflich aktiv und in verschiedenen Gesellschaftsbereichen wie Politik und Verbände engagiert und habt gelernt, euch vernehmbar zu machen. Habt ihr Tipps, wie uns dies auch besser gelingen kann?
Simone: Ein wichtiger Faktor ist aus meiner Sicht, dass wir als Menschen mit Behinderung uns selbst akzeptieren und lieben. Nur aus dieser Haltung kann es uns gelingen, uns auf eine gute und positive Weise für unsere Rechte einzusetzen.
Markus: Als Menschen mit Behinderungen werden wir wohl viel öfter nicht wertschätzend oder ungerecht behandelt. Wir hätten allen Grund, mit der Zeit verbittert zu werden. Das hilft aber weder uns noch unserem Umfeld, noch jenen, die uns übersehen oder übergehen. Es ist gut, wenn wir diesen Frust immer wieder bei Gott deponieren und ihn um Hilfe bitten können. Wenn wir lernen, aus einer inneren Ruhe heraus zu reagieren, dann können wir viel mehr bewirken, als wenn wir zu verbitterten Stänkerern werden.
Welche Erwartungen habt ihr an die Gesellschaft und auch an die Kirche/Gemeinde bzw. an die Menschen? Was müsste sich aus eurer Sicht ändern?
Markus: Ich wünsche mir Kirchen und Gemeinden, in denen alle willkommen sind; auch Menschen mit Behinderung. Das ist aber nicht einfach mit baulichen Massnahmen oder einem Inklusionskonzept getan. Es braucht eine entsprechende Herzenshaltung der Leitenden, welche die Kultur der Gemeinde prägt. Cool fände ich, wenn Christen aktiv auf Menschen mit Behinderung zugehen und sie einladen in unsere Gemeinde und fragen, was es denn braucht, damit sie Teil der Gemeinde werden können.
Simone: Meine Hoffnung ist es, dass Kirchen und Gemeinden mit der gleichen Selbstverständlichkeit Behinderung mitdenken, wie sie Kinder mitdenken. 15 % der Menschen in der Schweiz leben mit einer Behinderung und sind zugleich die am wenigsten mit dem Evangelium erreichte und in den Kirchen vertretene Bevölkerungsgruppe.
Die Kirche dürfte sich auch mehr in gesellschaftspolitischen Diskussionen für Menschen mit Behinderungen einsetzen. Im Zusammenhang mit der Abstimmung zum Thema «Ehe für alle» betonen gewisse christliche Kreise die Wichtigkeit von Vater und Mutter für das Kind. Dass es in der Schweiz Tausende von Kindern mit Behinderung gibt, die aufgrund von Lücken in unserem Sozialsystem nicht bei ihren Eltern aufwachsen können, hat aber noch nie jemand bemängelt geschweige denn etwas dagegen unternommen.
Abschliessend möchte ich betonen, dass es nicht darum geht, eine aus Sicht von Menschen mit Behinderung vollkommen gerechte Welt zu schaffen. Diese Gerechtigkeit gibt es hier in dieser Welt nicht. Aber es geht um eine Gesellschaft, in der alle gleich nach ihren Wünschen und Möglichkeiten teilhaben können.
| Markus Fankhauser ist 30 Jahre alt, von Beruf Jurist und engagiert sich politisch. |
| Simone Leuenberger ist Vorstandsmitglied von Glaube und Behinderung, lebt mit einer Muskelkrankheit und setzt sich beruflich und ehrenamtlich für die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung ein. |
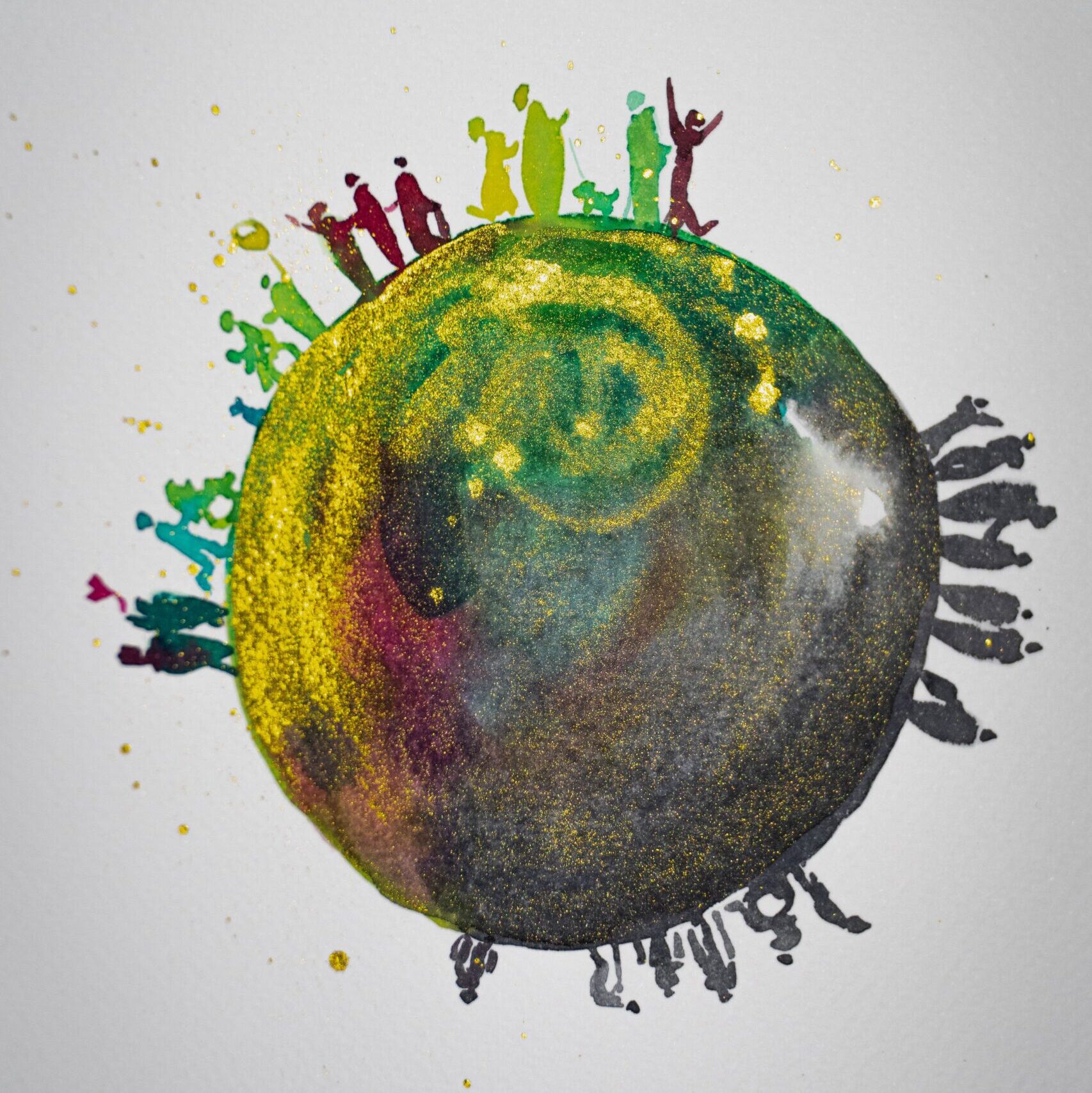
Liebe Simone
Du bist für mich eine kompetente Behinderte und ich profitiere immer wieder von deinen Meinungen oder Aussagen. Jetzt habe ich den Begriff ‚crip time‘ aufgeschnappt – es ist ja eine Tatsache, das wir mehr Zeit benötigen für fast alles.
Mir gefällt deine Homepage!
Herzliche Grüsse von Anita